Die Rüstungsaltlast Espagit,
in 10 Jahre, im
Spiegel der Karikatur
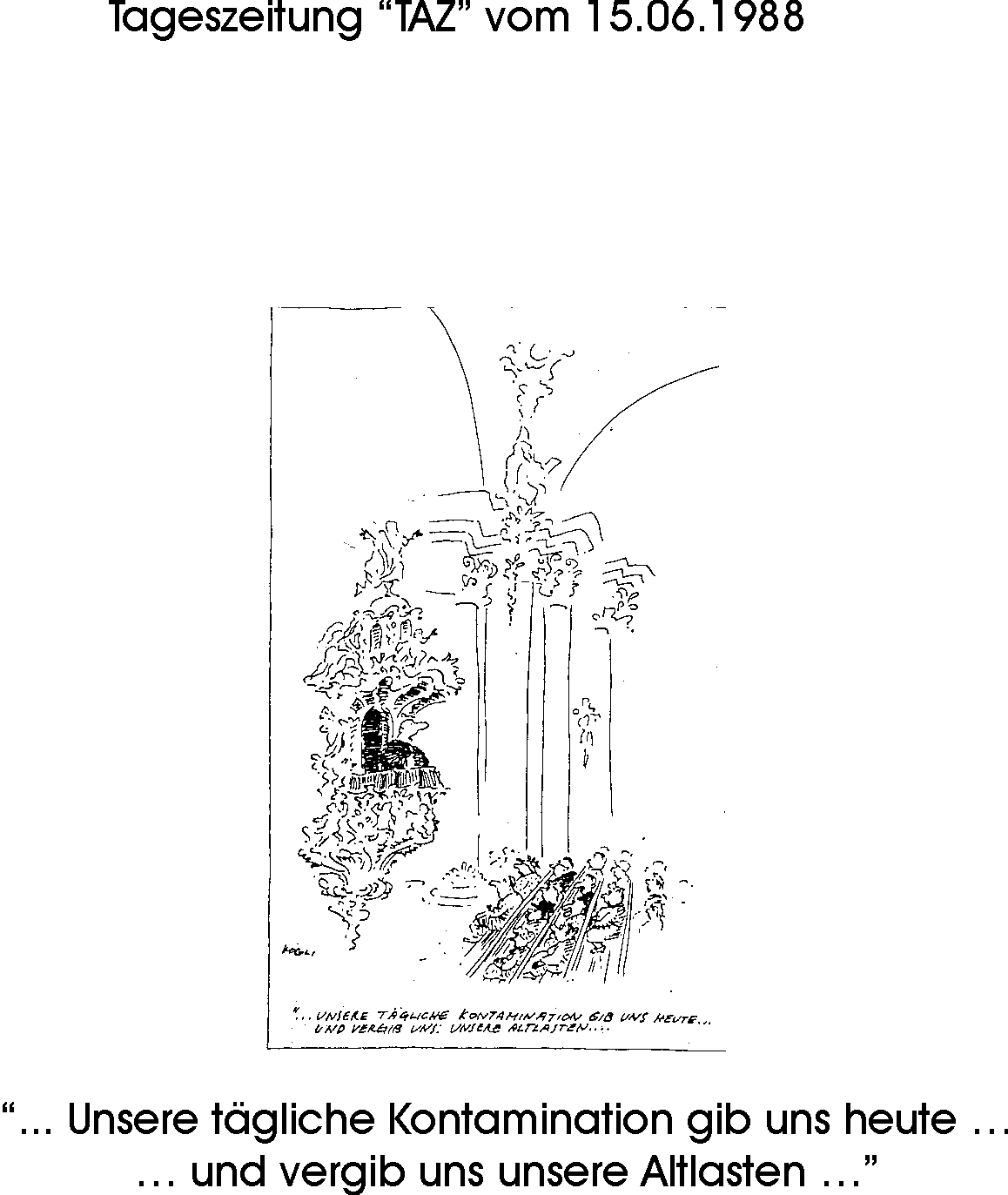
Seit der Explosion am 29.5.1920 und den vom Gewerbeaufsichtsamt Trier 1928 erklärten Gefahrlosigkeit des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik Espagit hatte das Gelände eine wechselvolle Geschichte. Im III. Reich wurden Westwall und Bunker gebaut, das Werksgelände blieb aber brach liegen. 1979 wurde sogar das ehemalige Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan als geringerwertige land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Ein Kölner Unternehmen aus der Sprengstoffbranche kaufte noch Geländeteile mit aufstehenden Trümmergebäuden auf, ließ Schilder aufstellen "Betreten verboten" und verpachtete das Gelände als Jungviehweide. Angeblich wurde behördlicherseits keinerlei Auffälligkeit bemerkt.
Im April 1988 wurde von den GRÜNEN die vermutete Altlast mit Medienspektakeln aufgedeckt.
Doch die Behörden kochten das Problem zunächst klein.
Gibt es eine Altlast oder gibt es sie nicht?
Längst hat die Presse das Töchterchen eines Bauern auf dessen Wiesen gefundenen Granaten des I. Weltkrieges abgelichtet.
Und die Bauern sagte: "Wir haben immer wieder Granaten gefunden und Sprengstoffbrocken, bis Kopfgröße"
Da läßt der Zeichner der Berliner Tageszeitung TAZ den Pfarrer von der Kanzel im Anklang an das VATERUNSER tönen ... "unsere tägliche Kontamination gib uns heute ..."
Gibt es doch eine Altlast?
Nachdem die Behörden über Monate, seit April 1988, ihr angebliches oder tatsächliches Nichtwissen geoffenbart hatten und verkündeten, daß die Experten des Kampfmittelräumdienstes bei Begehungen auf dem Gelände keine Auffälligkeiten feststellen konnten, fanden zur Befriedigung des Medieninteresses einige Baggerschauspiele statt. So wurden am ehemaligen Sozialgebäude und der Heizung unmittelbar an den Fundamenten geschürft und Proben entnommen. Genau Stellen, wo man mit Sicherheit keine Munition vergraben hatte oder Produktionsrückstände erwarten mußte.
Dann wurde im ehemaligen Produktionbereich vor laufenden Fernsehkameras gezeigt, daß auch hier nicht das Geringste zu finden sei. Man baggerte dabei genau auf der Trasse der ehemaligen Werksstraße.
Dann verschwanden die Medienvertreter wieder.
Ende Juni 1988 endlich begann der Kampfmittelräumdienst mit einer ersten ernsthaften Suche nach vergrabenen Granaten auf dem Werksgelände. Und stach gleich in ein Wespennest, obwohl die Suche mit Metalldetektoren dort recht problematisch war, weil überall Metall im Boden lag.
Gleichwohl unterschätzten die Behörden immer noch die wahre Situation. Am 29. Juni 1988 verkündete Regierungsdirektor Brühl über den Radiosender RPR in Trier: "Die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes dient zur Zeit lediglich zur Beruhigung der Bevölkerung." Brühl bezeichnete die ganze Aktion als "Flop".
Dennoch passierte am gleichen Tag noch, was nach Behördenansicht eigentlich nicht sein durfte: Innerhalb weniger Stunden lagen 15 dicke Brocken offen: 50-Kilo-Granaten aus dem Ersten Weltkrieg. (Heerwagen der die Grabung als "Reissighaufen" versteckt beobachtet hatte, meinte: "Es waren die Mehrzahl 15 cm Granaten mit einem Gewicht von je ca. 30 Kg und 5 bis 6 vom Kaliber 7,5 cm etwa fünf Kilogramm schwer"). Die Zünder waren entfernt, aber die Granaten waren noch voller Sprengstoff.
"Davon sind wir überrascht worden", räumte ein Sprecher des Mainzer Innenministeriums später gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger ein. Der Granaten-Fund brachte etwas Schwung in die Behörden. Innenminister Rudi Geil persönlich ordnete einen zügigen Fortgang der Arbeiten bei der Espagit an.
Denn nun war klar:
Der "Persilschein" der Gewerbeaufsicht von 1928 war ...
ein Flop.Ein von Heerwagen belauschtes Gespräch der Kampfmittelräumer am frühen Vormittag des 29.6. gab einen wichtigen Hinweis zur Alarmierung der Presse. "Wann kommt der?" Antwort "um 14 Uhr". "landet der hier?" Nein, der wird in Prüm vom Brühl abgeholt".
 So hatten auch die Reporter ihre Startprobleme. Als am Vormittag des 29. Juni die Granaten ausgegraben wurden, gab es für die Reporter samt Heerwagen einen rüden Feldverweis unter der Androhung polizeilichen Zwanges. Der gegen 14 Uhr aus Mainz mit dem Hubschrauber eingeflogenen Polizeidirektor Manfred Fey ließ nicht mit sich spaßen und drohte gar mit Verhaftung.
So hatten auch die Reporter ihre Startprobleme. Als am Vormittag des 29. Juni die Granaten ausgegraben wurden, gab es für die Reporter samt Heerwagen einen rüden Feldverweis unter der Androhung polizeilichen Zwanges. Der gegen 14 Uhr aus Mainz mit dem Hubschrauber eingeflogenen Polizeidirektor Manfred Fey ließ nicht mit sich spaßen und drohte gar mit Verhaftung.
Was sogar den sonst eher coolen Manfred Reuter vom Trierischen Volksfreund in Rage brachte. Er kommentierte: "...Selten haben sich Journalisten so angeschmiert gefühlt. Mit erschreckender Arroganz wurde dabei der Öffentlichkeit entgegen getreten, und diese hat immer noch das Recht, aus erster Hand zu erfahren, was Sache ist. (...) Fakten gab es bislang nur wenige und das von Amts wegen verbale Beruhigungsmittel "unbedenklich" erinnere an die offiziellen Verlautbarungen nach der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl."
Bald trat ein zusätzliches Problem zu Tage: Wenn tatsächlich in großen Mengen Granaten auf den 30 Hektar großen Produktionsgelände lagen, dann war Man-Power gefragt. Und die war beim Sprengkommando des Landes Rheinland-Pfalz nicht vorhanden. Der staatliche Kampfmittelräumdienst bestand aus ganzen 16 Männern, davon fünf für den Regierungsbezirk Trier. Zum Vergleich: Im Jahr 1988 gab es in Nordrhein-Westfalen 135 staatliche Kampfmittelräumer. Der Grüne Landtagsabgeordnete Dr. Harald Dörr, der sich später über viele Jahre engagiert für die Sanierung des Espagit-Geländes einsetzte, regte daher an, den NRW-Räumdienst um Hilfe zu bitten. Wenig später räumte der Sprecher des Mainzer Innenministeriums, Jürgen Dietzen ein, dass man wohl mit privaten Räumfirmen verhandeln müsse, mangels eigener Kapazitäten. Dietzen bewies schon damals Weitblick: "Das wird Millionenbeträge erfordern." Bereits im Juli führte Regierungsdirektor Brühl Vertreter dreier renommierter Kampfmittel-Räumfirmen über das Gelände. Das waren die Unternehmen Lenz aus Düsseldorf, Tauber aus Münster und Schollenberger aus Friesoyte. Alle verfügten bereits über große Erfahrung im Umgang mit Granatenbergungen.
Bis zum Herbst sollten die Firmen ihre Angebote abgeben.
Anfang Mai 1991 sollte die Sanierung dann wegen enormer Kosten verschoben werden. Das sagte der Regierungssprecher der noch amtierenden CDU-Landesregierung Jo Dietzen.
Und dann, unmittelbar vor dem Zusammentreten der neuen Landesregierung (SPD/FDP), wurden plötzlich am Nachmittag des Freitags vor Pfingsten Granaten gefunden, davon auch sogenannte flüssig gefüllte Geschosse.
Ohne Anwohner zu informieren, wurden diese durch Kampfmittelräumer in Vollschutzanzügen geborgen.
Es kommt sicherlich relativ selten vor, dass Vertreter von Behörden die Bürger in die Kneipe schicken. Und doch: Pfingsten 1991, am Freitag, 17. Mai, geschah genau das am Rande des Espagit-Geländes, nachdem aus Behörden-Sicht der GAU eingetreten war, der "größte anzunehmende Unfall": Man hatte eher zufällig ein Dutzend Giftgas-Granaten aufgestöbert, und die mussten angeblich sofort und in höchster Eile geborgen werden - nachdem sie fast 70 Jahre genau dort im Dreck gelegen hatten.
Ein Vermesser war auf dem Gelände über eine offen liegende Granate gestolpert. Als das Räumkommando den Sprengkörper bergen wollte, stießen die Feuerwerker auf ein ganzes Granatengrab dicht unter der Erdoberfläche. Dort lagen - wie aufgestapelt - 30 Granaten. 11 davon waren flüssig gefüllt, wie die Feuerwerker am Glucksen merkten, wenn sie die Granaten bewegten. Und genau diese flüssige Füllung der 7,5-cm-Munition war es, die bei den Behördenvertretern sofort alle Alarmglocken schrillen ließ. Flüssige Füllung deutete auf Kampfgas hin, wobei natürlich zunächst keiner sagen konnte, um welchen Kampfstoff es sich handelte, weil die ursprüngliche Farbmarkierung weggerostet war. Man musste mit dem Schlimmsten rechnen.
Der Räumdienst schritt unverzüglich ans Werk, wobei sich die Männer natürlich branchenüblich maskierten und in Schutzkleidung hüllten. "Zum Teil von Hand" habe man die Granaten im Lauf des Freitages aus der Erde holen können, bestätigte Helmut Kraus von der Trierer Bezirksregierung: "Wir haben dort Kampfstoffe vermutet, und das hat sich jetzt bestätigt." Noch am Freitagabend wurden die Granaten zum Kampfmittel-Lager nach Helenenberg zwischen Bitburg und Trier gebracht. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich dieses Lager Helenenberg aber eher als ein Witz. Viele Fundmunition wurde dort einfach im Freien gelagert, wie man einem späteren Bericht der Kölnischen Rundschau entnehmen konnte.
Dort sollte eine nordrhein-westfälische Firma kurzfristig die Granaten röntgen, um so den flüssigen Inhalt zu bestätigen. Welcher Kampfstoff im Inneren der stählernen Granaten schlummerte, wusste man danach allerdings immer noch nicht. Um das zu erfahren, hätte man - unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen - den Inhalt chemisch analysieren müssen. Das lehnten die rheinland-pfälzischen Behörden jedoch konsequent ab. Erstens wegen der Kosten, und zweitens, so wurde argumentiert, wisse man nach der Analyse auch nur über den Inhalt dieser einen untersuchten Granate bescheid. Über die Flüssigkeit in den anderen Granaten könne man danach allenfalls spekulieren.
Das war die offizielle Lesart. Es gibt jedoch noch eine zweite Deutung der Verweigerung genauer Analysen: Das erleichterte es nämlich den Behörden bis zum heutigen Tag zu behaupten, man habe bei der Espagit "kampfstoff-verdächtige Munition" gefunden. Das Wort "Gas-Granaten" meiden die Trierer und Mainzer wie der Teufel das Weihwasser. Im Gegenteil korrigieren sie regelmäßig beispielsweise Journalisten, die Fragen nach dem "Kampf-Gas" stellen. Über die Gründe für diese Verschleierung darf man vorerst spekulieren.
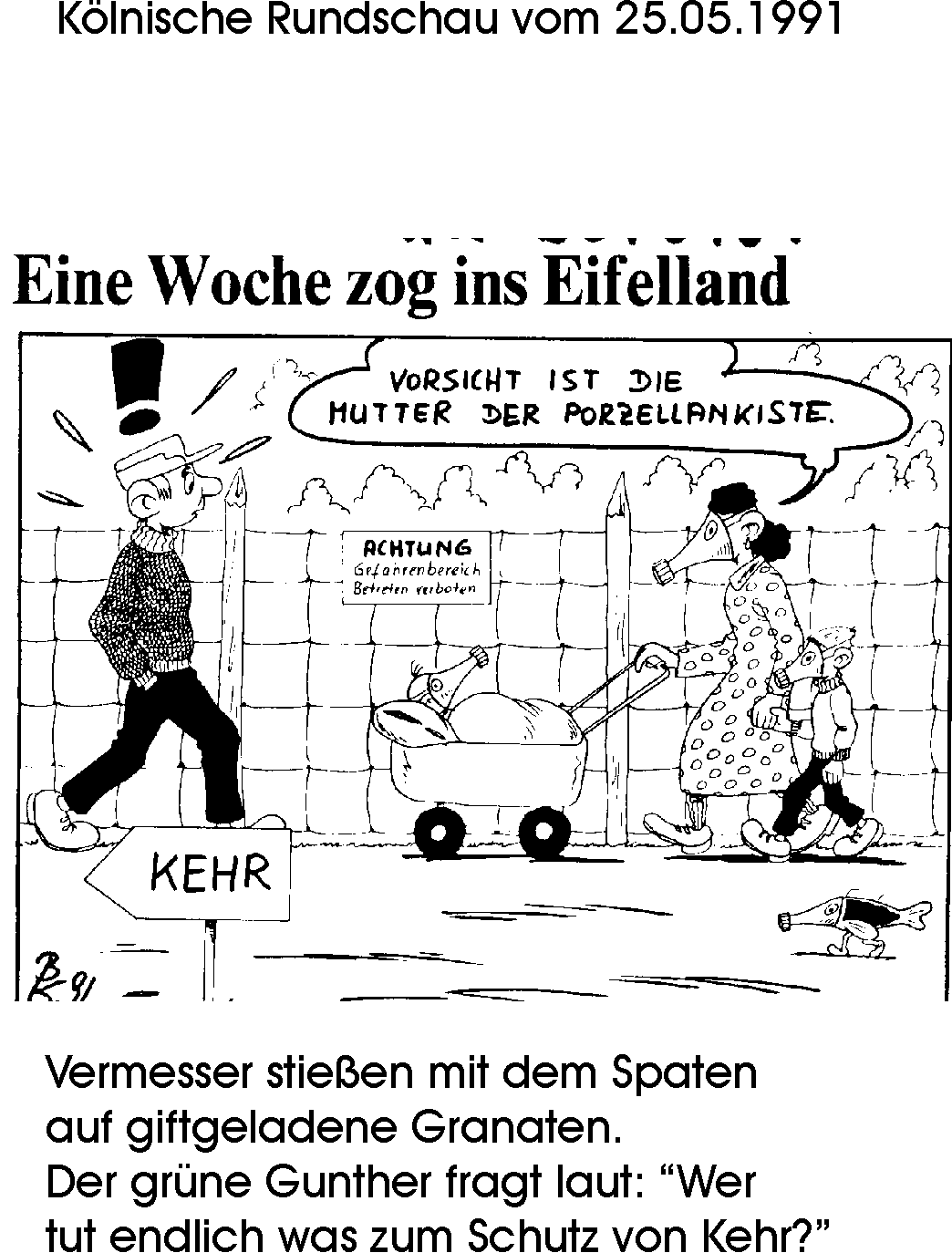 Jedenfalls gab es unmittelbar nach dieser Nacht- und Nebel-Bergung an der Espagit sofort politischen Beschuss durch die Grünen. Der Landtagsabgeordnete Dr. Harald Dörr (Grüne) forderte die soeben frisch gewählte neue Landesregierung am Tag ihrer Amtseinführung auf, die Bevölkerung nicht durch "übereilte und nächtliche Granatenbergungen im Stile einer geheimen Kommando-Sache zu irritieren". Wie Dörr gegenüber der Presse erklärte, sei seiner Ansicht nach die Bergung der "mutmaßlich hochbrisanten Kampfstoff-Granaten in äußerster Hektik ohne jegliche Schutz-Vorsorge für die anliegenden Bauernhöfe erfolgt". "Hohnsprechend" sei der den nächsten Nachbarn erteilte Rat, "entweder ins Wirtshaus zu gehen oder die Rolläden an den Fenstern herunter zu lassen".
Jedenfalls gab es unmittelbar nach dieser Nacht- und Nebel-Bergung an der Espagit sofort politischen Beschuss durch die Grünen. Der Landtagsabgeordnete Dr. Harald Dörr (Grüne) forderte die soeben frisch gewählte neue Landesregierung am Tag ihrer Amtseinführung auf, die Bevölkerung nicht durch "übereilte und nächtliche Granatenbergungen im Stile einer geheimen Kommando-Sache zu irritieren". Wie Dörr gegenüber der Presse erklärte, sei seiner Ansicht nach die Bergung der "mutmaßlich hochbrisanten Kampfstoff-Granaten in äußerster Hektik ohne jegliche Schutz-Vorsorge für die anliegenden Bauernhöfe erfolgt". "Hohnsprechend" sei der den nächsten Nachbarn erteilte Rat, "entweder ins Wirtshaus zu gehen oder die Rolläden an den Fenstern herunter zu lassen".
Tatsächlich stand diese panik-artige Bergung von Gas-Granaten in frappantem Gegensatz zu den Sicherheitsmaßnahmen, unter denen man später vorging, und die die Anwohner jahrelang vom Rest der Welt isolierten. Anzunehmen ist, dass es damals zu Pfingsten wirklich Kopflosigkeit war, die die Behörden zu ihrer Blitz-Bergung trieb, auch wenn Helmut Kraus von der Bezirksregierung und Thomas Kutzmann vom Innenministerium später ihr Handeln verteidigten.
Klar war anschließend, dass man auf dem Espagit-Gelände während der Sanierungsarbeiten eine sichere Lagermöglichkeit für die ausgebuddelten Granaten schaffen müsse. Insbesondere für die Gas-Granaten gab es ja vorerst keine Entsorgungs-Möglichkeit.
Total überrascht wurden auch die nordrhein-westfälischen Behörden im Kreis Euskirchen durch den Fund der Gas-Granaten. Die Ahnungslosigkeit der Kreisverwaltung begründete Franz Unterstetter mit der nach wie vor lückenhaften Informations-Politik der Rheinland-Pfälzer. So sei beispielsweise auch bei der Pfingst-Bergung der Kreis Euskirchen überhaupt nicht informiert worden, obwohl der nächstgelegene Ort Kehr zum Kreis Euskirchen gehört. Er verstehe diese Geheimhaltungs-Politik der Rheinland-Pfälzer überhaupt nicht, beklagte Unterstetter. Wenn Giftgas gefunden würde, müsste doch als allererstes die Rettungsleitstelle informiert werden. Eine entsprechende Beschwerde des Kreises Euskirchen sei bereits unterwegs, sagte der Amtsleiter.
Indessen protestierten die Grünen beim neuen Mainzer Innenminister Walter Zuber ziemlich energisch wegen der "Nacht- und Nebel-Aktion". Der Abgeordnete Dörr forderte Zuber dringend auf, dem wahllosen und unkoordinierten "Herumstochern in Bergen von 70 Jahre alten, rostigen Granaten" ein Ende zu machen. Der Kampfmittelräumdienst habe vom Land vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen einfach missachtet.
Seit dem Pfingst-Wochenende patrouillierten ständig Streifenwagen der Polizei im Espagit-Bereich. Die Beamten waren mit Gasmasken ausgerüstet, was wiederum der ungeschützten Bevölkerung zu denken gab.
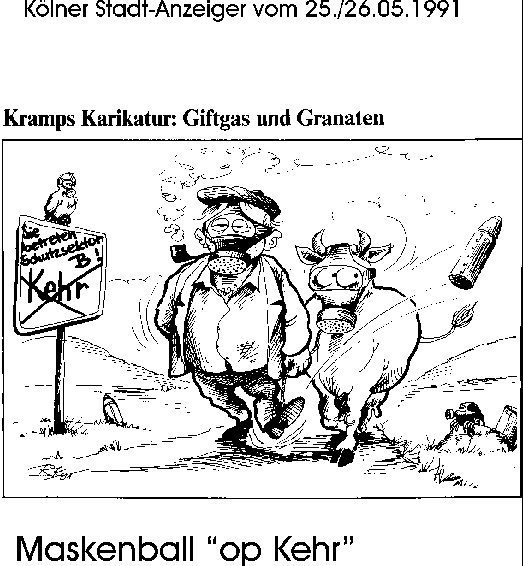
Die Mainzer "interministerielle Arbeitsgruppe" machte nun Dampf. Das für die Entmunitionierung entwickelte Sicherheitskonzept lag fertig auf dem Tisch. Das Umfeld der Espagit wurde in "Zonen" aufgeteilt, in denen - je nach Gefährdungsgrad - höhere oder niedrigere Sicherheitsstufen galten.
- Die sogenannte "C-Zone" umfasste den früheren Werksbereich, der inzwischen eingezäunt war. Dort hatten nur die Kampfmittelräumer und "berechtigte" Personen Zutritt.
- Die "B-Zone" wurde im Umkreis von etwa 1,3 Kilometer rund um die Räumstelle festgesetzt. Dort hatten nur die Anlieger mit Schutzausrüstung Zutritt sowie einige wenige, handverlesene weitere Personen, wie Briefträger oder der Milchwagen-Fahrer. Der am nächsten gelegene Ort Kehr wurde allerdings zunächst aus diesem Konzept völlig ausgeklammert.
- Die "A-Zone" ging bis etwa vier Kilometer um die Räumstelle. Dort sei selbst beim größten anzunehmenden Giftgas-Unfall bei der Espagit allenfalls mit Augenreizungen zu rechnen. Deshalb sollten die Bewohner in diesem Bereich im Ernstfall lediglich von der Straße in ihre Häuser gescheucht werden.
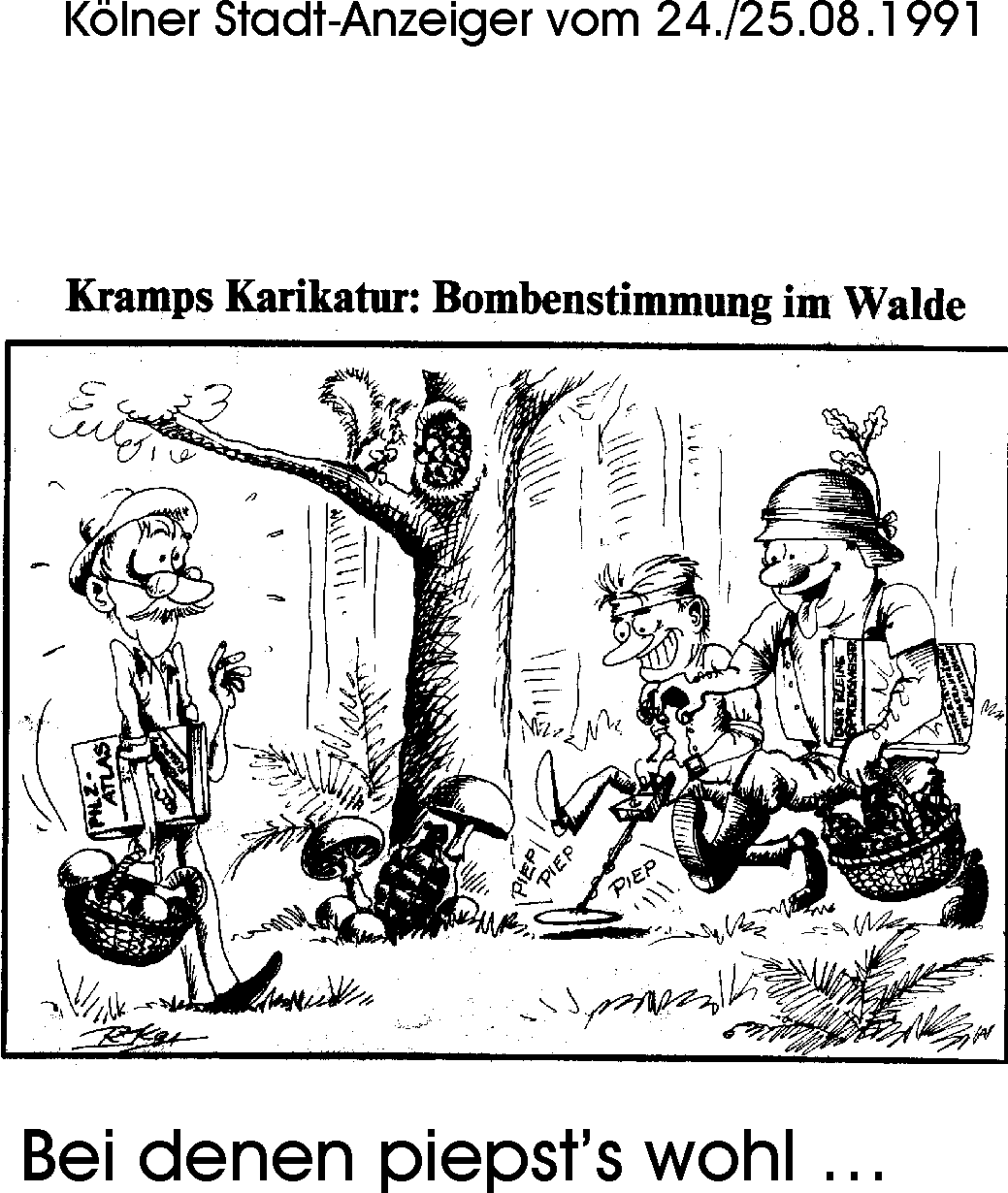
Munitionssuche läuft an
Der Entdecker der Altlast, Gunther Heerwagen, tummelte sich derweil weiter munter im Gelände rund um die Espagit. Dort bewegte sich nichts, wovon er nicht Wind bekommen hätte - und das er dann natürlich auch sofort der Presse steckte.
Heerwagen stand dem Sanierungsplan der Mainzer von vorne herein eher skeptisch gegenüber. Ja, er hielt ihn für schlichtweg unsinnig. Die Begründung: Es mache keinen Sinn, mit Millionen-Aufwand dort nach Granaten zu suchen, wo keine Menschen lebten, wo dank der starken Absicherung inzwischen auch keiner mehr hin kommen konnte: In der C-Zone. Sinn mache die Suche vielmehr genau da, wo die Menschen in Gefahr waren: Im Streukreis der Explosion, also im Umkreis von rund zwei Kilometern um das Werksgelände. Dort lagen die Bauernhöfe, die Landwirte trieben ihr Vieh auf die Weiden, aus denen schon seit Jahrzehnten im Viehtritt oder beim Pflügen immer wieder Granaten ans Tageslicht kamen. "Da besteht akute Gefahr, dass etwas passiert", sagte der Grüne. Zudem wies er frühzeitig darauf hin, dass die Mainzer mit ihrer Wühlerei in der chemisch hochkontaminierten C-Zone an einer chemischen Bombe zündelten: Durch die Grabung nach Munition werde das Erdreich völlig vermengt, die im Lauf der Jahrzehnte inaktiv gewordenen und eingekapselten Chemikalien würden reaktiviert, sie könnten womöglich das Grundwasser vergiften.
Auch im Mainzer Landtag machten die Grünen Druck. Wenn man denn schon mit der Entmunitionierung in der C-Zone beginne, sollte gleichtzeitig die Beseitung der chemischen Verseuchung angegangen werden. Die Grünen bezeichneten es als "unverantwortlichen Schildbürgerstreich", dass die Espagit-Erde zwei Mal durchwühlt werden sollte.
Diese Argumentation ließen die federführenden Behörden nicht gelten. Sie beschworen weiterhin die große Granaten-Gefahr in der C-Zone herauf, und ohnehin passte es ihnen nicht, dass Heerwagen jede ihrer Handlungen kritisch und teilweise frech, aber meistens mit guten Argumenten, kommentierte. Und selbstverständlich wiesen die Trierer den Verdacht weit von sich, dass es außerhalb des Werksgeländes Granaten in nennenswertem Umfang gäbe.
Wie um das Gegenteil zu beweisen strich Heerwagen am Sonntag, dem 14. Juli 1991 mit einem Bekannten über die Wiesen südlich der Espagit. Rund 600 Meter vom Werksgelände entfernt stießen die beiden auf zwei rostige Granaten vom Kaliber 7,5 cm, die dicht an der Erdoberfläche lagen. Eine unbezünderte Granate gluckste vernehmlich, als Heerwagen sie bewegte. Die zweite Granate gluckerte nicht mehr, woraus Heerwagen ableitete, dass sie wohl irgendwann in den letzten 70 Jahren ausgegast sei. Die Polizei, die in der Nähe immer noch das tolle Giftgas-Zwischenlager der Behörden am Müll-Container bewachte, wurde informiert.
Am Abend rückte der Kampfmittelräumdienst an und barg die Granate. Diesmal wurden auch die Anwohner informiert und aufgefordert, im Haus zu bleiben. Im Gegensatz zu allen anderen Anwesenden, einschließlich Polizei und Presse, konnte der federführende Feuerwerker Horst Lenz allerdings kein Glucksen in der Granate hören. ...Vielleicht verursachte sein Vollschutz-Anzug zu viele Geräusche.
Heerwagens Fund gab dem Innenminister Walter Zuber persönlich zu denken, wie er im Gespräch gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger einräumte. Er kündigte an, dass nun auch Sondierungen im Außenbereich statt fänden. Je nach dem Ergebnis wolle er nicht ausschließen, dass man über eine zeitweilige Evakuierung der Aussiedlerhöfe nachdenken müsse. Doch Zubers Ministerialbürokratie ließ diesen Denkansatz des Ressortchefs bald wieder untergehen. Bis 1999 blieb es dabei: Gezielt nach Munition gesucht wurde nur in der C-Zone.

Fehlalarm
Im Sommer 91 begann das Räum-Unternehmen Tauber mit dem Aufbau seines Container-Camps am Rande der C-Zone, an der Straße von Kehr nach Scheid. Sicherheitshalber wurde der Boden da, wo die Container aufgestellt werden sollten, erst mal gründlich entmunitioniert. Auch wurden Bodenproben gezogen und in einem gas-chromatografischen Massenspektrometer analysiert. Erst dann wurden auf zwei Geschoss-Ebenen die Wohn- und Arbeits-Container aufgebaut.
Am Montag, 19. August, reisten Experten des Amtes für Wehr-Geo-Physik in der Eifel an, um das Schwergas Schwefel-Hexa-Fluorid aus Flaschen strömen zu lassen. Mit Hilfe sensibler Messtechnik sollte exakt ermittelt werden, wie schnell und wohin bei welcher Windgeschwindigkeit und Wetterlage sich im Ernstfall eine Kampfgaswolke ausbreiten würde. Das diente letztlich zur Aufklärung der Frage, ob die bis dahin theoretischen Erwägungen der Fachleute über die Ausbreitung dem Praxistest stand hielten.
Dann war mal wieder Politiker-Auftrieb angesagt. Am Donnerstag, 22. August 91 tagten Innen- und Umweltausschuss aus Mainz gemeinsam in Hallschlag. Mit dabei die beiden Ressortchefs, Umweltministerin Klaudia Martini und Walter Zuber (Inneres). Zuber kündigte an, dass vor Beginn der Sanierung rund um die Altlast Kontrollbrunnen eingerichtet würden. Damit sollte festgestellt werden, ob durch die Granatensuche eventuell Giftstoffe aktiviert würden, die das Grundwasser verseuchten. Inzwischen sei nämlich bekannt, dass durch ein Kluftsystem im Untergrund Wasser und damit transportierte Gifte ins Grundwasser gelangen könnten.
 Im Zuge der Diskussion meinte der Grüne Abgeordnete Dietmar Rieth: "Hallschlag wird wohl die gefährlichste Räumung, die es bisher in der Bundesrepublik gegeben hat."
Im Zuge der Diskussion meinte der Grüne Abgeordnete Dietmar Rieth: "Hallschlag wird wohl die gefährlichste Räumung, die es bisher in der Bundesrepublik gegeben hat."
Mehrere Fehlalarme nervten die Anwohner.
Anfang Januar 1993 sorgte Heerwagen wieder einmal mit dem Fund einer Gasgranate für einigen Wirbel. Der Grüne hatte den Sprengkörper auf dem Baustellengelände einer Paletten-Fabrik bei Losheim, auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen entdeckt. Da lag sie auf dem frisch planierten Baugrundstück, als Heerwagen sie fand. Jedenfalls behauptete er das. Und dann ließ er auch noch ein paar Tage verstreichen, bevor er die Behörden informierte. Fast noch schlimmer: Heerwagen hatte erst die Presse und dann die Polizei informiert. Als hätte er eine Ahnung gehabt, hatte Heerwagen kurz vorher einen Neujahrsgruß an den Trierer Regierungspräsidenten geschickt mit der Aufforderung, auch außerhalb des Werksgeländes nach Munition zu suchen. Da könne Gefahr bestehen.
Trotz Heerwagens Warnungen waren mehrere tausend Quadratmeter beim Bau eines Sägewerkes nicht nach Munition abgesucht worden, obwohl Zeitzeugen der 1920 stattgefundenen Explosion von zahlreichen umhergeflogenen Granaten berichtet hatten. Sogar noch 500 Meter weiter war eine etwa 30 Kilogramm schwere 15 Zentimeter-Granate bis zur damaligen Gaststätte Braun am Grenzübergang Losheim-Hergersberg geflogen.
Immerhin hatte Heerwagens Presse-Spektakel einige Konsequenzen. So suchte beispielsweise der NRW-Räumdienst nun auch im Raum Losheim, zumindest stichprobenartig. Zum anderen handelte Heerwagen sich ein Ermittlungsverfahren ein wegen des Verdachts eines "Verstoßes gegen das Kriegswaffen-Kontroll-Gesetz". Die Schleidener Polizei zettelte die Anzeige an, weil Heerwagen die Behörden tagelang nicht darüber informiert hatte, dass bei Losheim eine Granate läge. Natürlich mußte das Verfahren eingestellt werden.

Doch derlei Attacken verdrossen Heerwagen nicht sonderlich. Er attackierte munter weiter die Behörden, wenn er das Gefühl hatte, es würden Fehler gemacht.
Schon im März wurde er wieder fündig, als das Innenministerium eine Anfrage des Abgeordneten Dörr beantwortete. "Erst ab 1991" sei Munition aus dem Ersten Weltkrieg bei Kehr gefunden worden, behaupteten die Ministerialen. Das war natürlich schlichtweg falsch, denn schon 1988 hatte der Kölner Stadt-Anzeiger ein Foto von der Tochter eines Bauern mit mehreren Granaten aus dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht. Und die Bauern schworen Stein und Bein, dass sie seit Jahrzehnten alle Nase lang solche typischen Granaten ohne Zünder gefunden hätten. Die hätten sie immer beiseite gelegt, bis der Kampfmittelräumdienst sie irgendwann zur Vernichtung abgeholt habe.
Wenn nun das Innenministerium behauptete, dass all diese von den Bauern abgelieferten Granaten nicht als Munition aus dem Ersten Weltkrieg erkannt worden seien, warf das ein ziemlich schiefes Bild auf den rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienst. Viele dieser Granaten waren mit Sicherheit Gasgranaten. Grob gerechnet jede zehnte bis heute bei Kehr gefundene Granate ist immerhin flüssig gefüllt.
Das wirft die brisante Frage auf, ob das Trierer Sprengkommando in völliger Unwissenheit die früher gefundenen Kehrer Gas-Granaten mit der übrigen Sprengmunition zusammen einfach in die Luft gejagt hat. Das roch nach einem Skandal, meinte nicht nur Heerwagen. Gemessen am teilweise grotesken Sicherheitsaufwand, der Anfang der 90er Jahre wegen der Gasgranaten betrieben wurde, mutete der frühere offenkundig sehr legere Umgang der Feuerwerker mit dem Teufelszeug ziemlich selbstsam an. Heerwagen damals: "Für wie dumm halten Landesbehörden eigentlich die Öffentlichkeit und die Hallschlager Bauern?"
BOMBE in Redaktion
Auch der wackere und espagiterfahrene Stadt-Anzeiger-Journalist F.A. Heinen machte Bekanntschaft mit einem Sprengkörper.
Von einem Hilfstransport in Ostblockländer brachte ein Begleiter wohl die Werfergranate mit.
Und nun wollte er sie loswerden.
Er suchte dazu die Euskirchner Redaktion des Stadt-Anzeigers auf, wollte jemanden sprechen und als niemand entsprechendes da war, legte er einfach eine Plastiktüte auf den Redaktionsschreibtisch und sagte, daß er noch Einkaufen gehe.
F.A. Heinen, von der Sekretärin auf diese Tüte aufmerksam gemacht, erkannte mit geübtem Blick sofort den Explosivkörper als Werfergranate und rief, erfahrungs- und pflichtgemäß, sofort den Kampfmittelräumdienst an.
Der Kommentar der Kampfmittelexperten: "Es sei genug Sprengstoff in der Granate gewesen, um die Redaktionsfenster auszuglasen"
Der Zeichner Bernd Kehren der Konkurenzzeitung Kölnische Rundschau, würdigte das Ereignis mit untenstehender Karikatur.
Versuchskaninchen auf der Espagit
Der Kölner Stadt-Anzeiger vom 1. April 1993 berichtet von den Versuchskaninchen des Arztes Rafat R.
Kein Scherz:
,,Rammler" für die Sicherheit
Versuchskaninchen auf Munitionsräumstelle
Hellenthal-Kehr Es klingt wie ein Aprilscherz ist aber keiner: Jetzt hoppeln auf der Munitionsräumstelle bei Kehr auch noch ein paar Kaninchen im Dienste der Sicherheit. Die Stallhasen werden mit Futter versorgt, das auf dem mit mancherlei Giften verseuchten Bereich der früheren Granatenschmiede Espagit gewachsen ist.
Aus der Entwicklung des Geundheitszustandes der Mümmelmänner sollen Rückschlüsse auf mögliche Gefahren an der Räumstelle gezogen werden. Der Stall steht im Bereich des Arbeitscamps. ,,,Es handelt sich um echte Versuchskaninchen", stellte Bürgermeister Werner Arenz kürzlich bei einem Besuch auf der Räumstelle fest.
Auch die Feuerwehrmänner und Katastrophenschutz-Experten, die vor zwei Wochen an einer Großübung in Kehr teilnahmen, nahmen die ungewöhnliche Kaninchenzucht überrascht zur Kenntnis. Offenbar wollen die Verantwortlichen bei der Mainzer Landesregierung in Kehr ,,auf Nummer Sicher" gehen.
Dem Augenschein nach geht es den Kaninchen allerdings ganz gut. Friedlich mümmeln sie den Tag über in ihren Ställen; sie stehen offensichtlich gut im Futter und haben ein glänzendes Fell. (fa)
Die erfolgte Strafanzeige wegen tierquälerischen (und wissenschaftlich unnützen) Versuchen wurde, wie üblich, von der Staatsanwaltschaft eingestellt.
Der Fall Rafat R.
Spionage bei der Espagit
Sein Job war die Sicherheit: Als Lagerarzt sollte der Palästinenser mit dem syrischen Pass auf den Namen Rafat R. im Espagit-Räum-Camp bei Unfällen mit Chemiewaffen helfen. Der Chirurg hatte eine entsprechende Fachausbildung. Zudem betrieb er eigene Forschungen auf dem Gelände. Unter anderem startete er Tierversuche mit Kaninchen. Die Mümmelmänner wurden teilweise mit Gras vom Espagit-Gelände gefüttert, eine Vergleichsgruppe bekam unverseuchtes Gras. Was das sollte, blieb Rafats Geheimnis.
Geheimnisse hatte der damals 43-jährige Lagerarzt noch mehr. So traf er sich beispielsweise schon mal - mehr oder weniger konspirativ - mit Mitarbeitern der syrischen Botschaft. Rafats Nachbarn in Kehr beobachteten das - eifel-typisch - von Anfang an ziemlich genau. Und auch ein anderer muss wohl so eine Art sechsten Sinn gehabt haben: Der Giftgas-Experte Hauptmann Robert Zellermann. Nachdem ihm Heerwagen über seine Bekanntschaft mit dem sich als syrischen Palestinenser bezeichnenden und erklärten Judenfeind erfahren hatte, äußerte er schon frühzeitig: "Nachtijall, ick hör, dir trapsen."
Und als Heerwagen einem Bundeswehroffizier auch noch von Konstruktionszeichnungen auf Rafats Schreibtisch mit einer heute von Israel in Lizenz gebauten Bremsfallschirmbombe berichtete, erwähnte dieser nur trocken: "Übrigens, am Montag habe ich auf der Dienststelle israelischen Besuch".
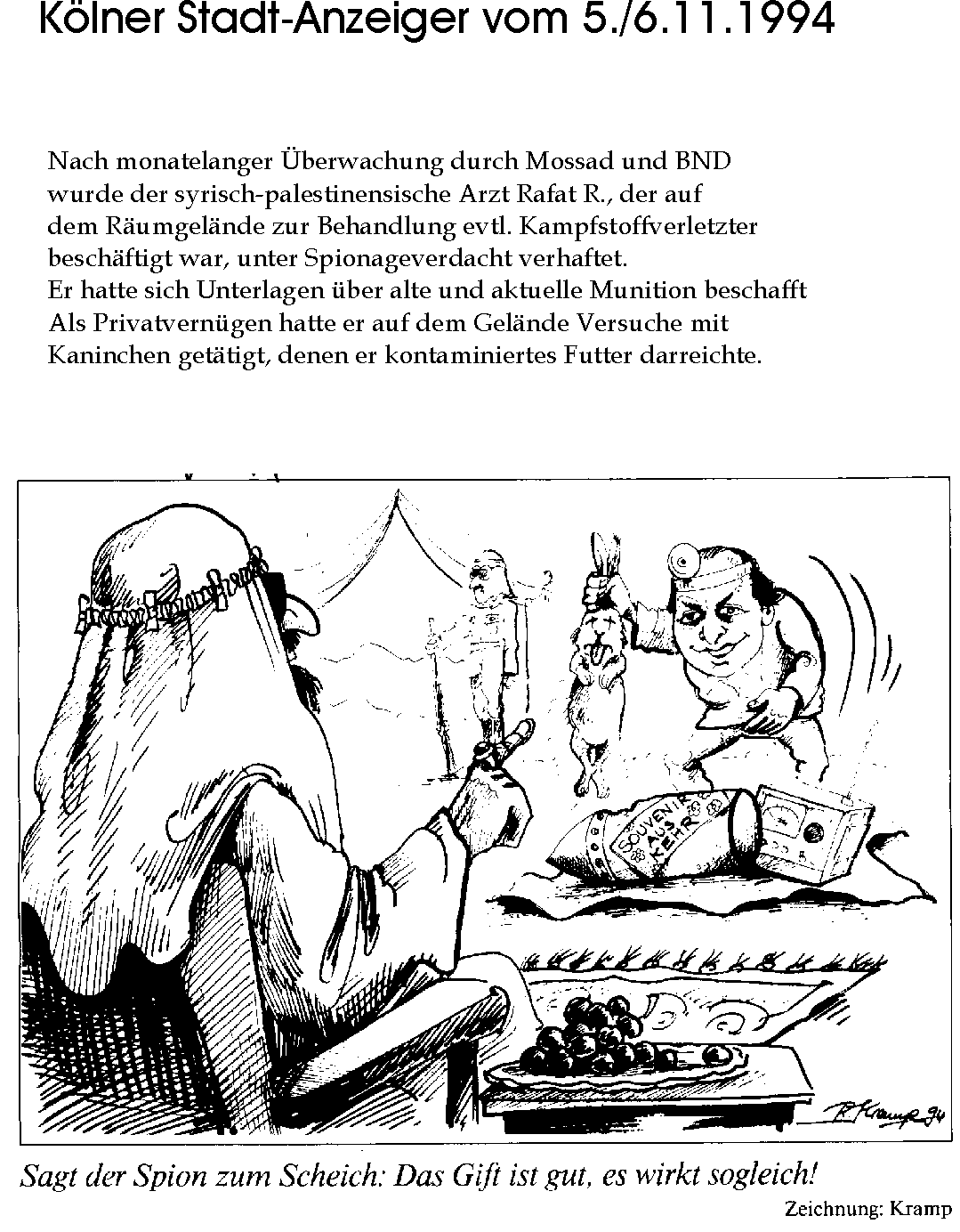
Im Jahr 1994 konnte man häufig mancherlei fremde Autos rund um Espagit, Kehr und Hallschlag beobachten. Die Insassen waren eher unauffällige Typen, Marke Schlapphut. Der Verfassungsschutz hatte - vermutlich vom israelischen Geheimdienst Mossad - einen Hinweis darauf bekommen, dass Rafat für einen syrischen Geheimdienst spioniere. Er sollte im Rahmen seiner Arbeit auf der Espagit Informationen beschafft und an den nahöstlichen Geheimdienst weiter geleitet haben.
Ende Oktober klickten in Kehr die Handschellen, das Bundeskriminalamt nahm Rafat vorläufig fest. Einen Tag später erließ auf Antrag von Generalbundesanwalt Kay Nehm der Bundesgerichtshof Haftbefehl wegen geheimdienstlicher Agenten-Tätigkeit. Rafat wanderte in Untersuchungshaft. Konkret vorgeworfen wurde ihm der Verrat von aktueller NATO-Technik. Aber Fachleute meinten, für ein Land wie Syrien könne durchaus auch die Giftgas-Technik aus dem Ersten Weltkrieg von Interesse sein. Die damals in Europa verwendeten Produktions-Verfahren seien durchaus auch heute noch aktuell. Und darüber fand man in der Bücherei des Tauber-Räumcamps natürlich alle gewünschten Informationen.
Ein Experte damals zum Kölner Stadt-Anzeiger: "Alle Schwellenländer meinen, sie müssten diesen zweitgrößten Knüppel haben, weil sie sich nukleare Waffen nicht leisten können." Der Lungen-Kampfstoff Phosgen aus dem Ersten Weltkrieg sei heute noch so aktuell wie früher.
Natürlich machte der Abgeordnete Dietmar Rieth im Mainzer Landtag Zoff wegen der angeblichen Spionagegeschichte. Und auch die Bundesregierung musste sich mit dem Fall Rafat befassen, nachdem die Grünen eine entsprechende Anfrage gestellt hatten. Die Regierung Kohl machte allerdings die Schotten dicht: "Die Angelegenheit ist nach Auffassung der Bundesregierung für eine öffentliche Erörterung nicht geeignet. Sie nimmt dazu nur in dem dafür vorgesehenen parlamentarischen Gremium Stellung."
Das lieferte natürlich dem öffentlich gewordenen Verdacht Nahrung, dass es sehr wohl in der Eifel um Kampfgas gegangen sein könnte. Was die Bundesregierung allerdings mit dem lapidaren Hinweis bestritt, dass diese Technik heute in der Literatur ohnehin allgemein zugänglich sei.
Am Mittwoch, dem 10. Mai 1995 war es so weit: Der Prozess gegen Rafat R. begann im Saal "A 01" im Keller des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Dort war bereits Justizgeschichte geschrieben worden: Der erste abhörsichere Verhandlungsraum in einem deutschen Gericht wurde speziell für den Prozess gegen Kanzleramtsspion Günter Guillaume gebaut, um gegnerischen Diensten die Berichte der westdeutschen Spionageabwehr vorzuenthalten.
Der 43jährige Arzt zeigte sich von Beginn der Verhandlung an äußerst kooperativ. Er legte ein umfassendes Geständnis ab. Im Espagit-Camp habe er sich Unterlagen über moderne NATO-Waffensysteme beschafft. Diese Papiere habe er an den Militär-Attaché der syrischen Botschaft weiter geleitet. So kamen die Papiere in die Hände des syrischen Geheimdienstes.
Im Zuge der ausführlichen Befragung des Angeklagten wollte der Vorsitzende Richter des 4. Strafsenats, Dr. Klaus Wagner, zunächst Rafats persönliche Geschichte hören. Er sei als Sohn eines palästinensischen Flüchtlings in der syrischen Hauptstadt Damaskus geboren, erzählte Rafat. Nach der Schule kam er zum medizinischen Studium nach Deutschland, wo er seit 1980 an verschiedenen Krankenhäusern als Assistenzarzt wirkte. Ab 1986 arbeitete er auf den verschiedenen Räumstellen der Firma Tauber als medizinischer Experte für Giftgas-Unfälle. 1990 erhielt Rafat die deutsche Staatsbürgerschaft, seit 1991 war er auf dem Espagit-Gelände. Er sei alkoholkrank, räumte Rafat ein. Aber er besitze persönlich über 200.000 Mark sowie wertvolle medizinische Geräte, mit denen er in Syrien ein "Feldlazarett" aufbauen wolle.
Um sich in seiner Heimat vom Wehrdienst frei zu kaufen, habe er 5000 Dollar nach Damaskus überwiesen. Aber immer wieder tauchte sein Name auf den Grenz-Fahndungslisten auf. Diese Fahndung bildete wohl auch den Hebel, mit dem der Geheimdienst ihn zur Mitarbeit nötigte.
Immer wieder, so Rafat, bekam er Besuch vom Kultur- und Militär-Attaché seiner Botschaft, Said Issa, der sich auch "Abu Ahmed" nannte, "Vater des Achmed". Mit Issa habe er sich angefreundet, schilderte Rafat vor Gericht, zumal beide in Syrien die gleiche Schule besucht hätten. Issa habe ihn über Landsleute in Deutschland ausgefragt, unter anderem über die in Aachen ansässige Moslem-Bruderschaft. Aber auch über einen syrischen Piloten, der seiner Heimatluftwaffe angeblich mit einem MIG-Düsenjäger nach Frankreich entfleuchte, und der nun in Deutschland lebe.
Bei solchen Fragen habe er sich mit der Antwort jeweils sehr zurück gehalten, betonte Rafat. Zu denken gab ihm auch, dass Issa ihm Kontakte zum israelischen Mossad unterstellte. Aber das könne ja gar nicht sein, meinte Rafat voller Empörung im Gericht: "Als Palästinenser nie!" Während des Golfkriegs habe Issa gefragt, wo man in Deutschland ganz schnell 50.000 Gasmasken bekommen könne.
Anfang der 90er Jahren drängten die Syrer immer mehr, und schließlich führte Rafat seine "Freunde" über das Espagit-Gelände. Dabei sahen die Syrer, dass Rafat Zugriff auf diverse militärische Unterlagen hatte. Er wurde aufgefordert, Kopien davon zu liefern, was der Arzt nach eigenem Eingeständnis auch tat.
Darunter waren Dokumente über NATO-Raketen, einschließlich des Patriot-Raketensystems, der einzigen Abwehrwaffe der Israelis gegen Saddams Scud-Raketen. Aber auch über eine israelische Fallschirm-Bombe lieferte Rafat Informationen.
Damals hörte die deutsche Abwehr schon bei Rafats Telefonaten mit. Denn eine "besonders schutzwürdige Quelle" habe dem Kölner Verfassungsschutz einen Hinweis auf Rafat gegeben. Das berichtete ein unter falschem Namen als Zeuge auftretender 42-jähriger Regierungsdirektor vom Verfassungsschutz. Bei der "Quelle" ahnte jeder im Gerichtssaal, dass es sich wohl um den Mossad handelte.
Nach dem guten Tip habe die G-10-Kommission der Bundesregierung am 24. Mai 1993 den Lauschangriff gegen den Syrer genehmigt. Bis zur Festnahme anderthalb Jahre später schnitten die Geheimen alle Gespräche Rafats mit. Seither knackte der Verfassungsschutz beispielsweise einige Code-Namen der Syrer. Wenn beispielsweise vom "Handball" die Rede war, waren Handgranaten gemeint, was ja nicht gerade von großem Erfindungsreichtum zeugte. Funkgeräte wurden als "Waschmaschinen" kodiert.
Nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen klebten die deutschen Schlapphüte an Rafats Fersen. So observierten die Geheimen unter anderem schon ein Jahr vor der Verhaftung, wie Rafat in Losheim auf einem Flohmarkt ein altes militärisches Funkgerät samt Plänen kaufte und das Ding später an Issa weiter gab.
Irgendwann fühlte Rafat sich von Issa zu sehr bedrängt, als dieser von ihm 160.000 Mark für ein angebliches Geschäft in Syrien forderte. Zudem bezeichnete der Militär-Attache Rafats Informationen als wertlos. Woraus Rafat in seinen Garten in Kehr gegangen sei, um dort lagerndes weiteres Material zu verbrennen.
Rafat beschwerte sich ergebnislos beim Botschafter über Issa, wie er vor Gericht darlegte. Daraufhin habe der Attache ihn am Telefon nur als "naiv" bezeichnet und ausgelacht. Da endlich sei Rafat gedämmert, dass seine Informationen wohl doch nicht für die Minen-Räum-Kommandos am Golan gedacht seien, sondern vielleicht für den Geheimdienst.
Der Verfassungsschützer mit dem falschen Namen bestätigte während der Verhandlung, dass es eine Information des Auswärtigen Amtes vom 11. November 1993 gäbe, wonach Issa laut syrischem Botschafter tatsächlich Mitglied eines Nachrichtendienstes sei.
Die Tatsache, dass Rafat ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, beendete den Prozess überraschend schnell. Bereits am zweiten Tag plädierte nach der Mittagspause der Bundesanwalt. Die Anklage habe sich in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Als Motiv für die Spionage sah der Bundesanwalt Rafats Pläne zum Aufbau eines Feldlazaretts in Syrien. Um dieses Lebenstraum verwirklichen zu können, habe Rafat 1992 beschlossen, mit dem Geheimdienst zusammen zu arbeiten. Nötig wäre das allerdings nicht gewesen, denn er konnte in seine Heimat einreisen, obwohl er auf der Fahndungsliste stand. Ziel Syriens sei es gewesen, die Opposition im Ausland unter Kontriolle zu halten und auszuspähen. Das habe Rafat ablehnen können, weil er nicht erpressbar war. Aber er habe in seiner Freundschaft zu Issa einen Weg gesehen, seine Zukunftspläne in Syrien zu verwirklichen. Statt seine Landsleute zu verraten, habe er militärtechnische Unterlagen geliefert. Welche genau, und wie viele Unterlagen das waren, ließ sich vor Gericht nicht mehr aufklären. Fazit des Bundesanwalts: "So jemand ist ein Spion." Als strafmildernd wertete der Ankläger, dass der Bundesrepublik kein Schaden entstanden sei, wegen der frühzeitigen Überwachung durch den Verfassungsschutz. Hinzu kam das Geständnis. So blieb der Bundesanwalt mit seinem Antrag deutlich unter der Höchststrafe: Er forderte für Rafat anderthalb Jahre Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 20.000 Mark.
Rafats Verteidiger Werner Huth schloss sich dem Ankläger weitgehend an. Er bat lediglich darum, von der Geldstrafe abzusehen. Sein Mandant habe immerhin schon 198 Tage spürbar in der Untersuchungshaft gelitten.
Das letzte Wort hatte Rafat selbst: "Hoher Senat, ich hoffe, ich habe dem Image der BRD nicht geschadet und ich hoffe auf Ihre Gnade."
Am dritten Prozesstag verkündete der 4. Senat sein Urteil: Ein Jahr Haft auf Bewährung. Worauf Rafat sich von der Anklagebank erhob und schnurstracks zu seinen Richtern lief. Er schüttelte dem Vorsitzenden Dr. Klaus Wagner die Hand und sagte laut "danke!".
Es war Richter Wagners letzte Verhandlung vor dem Eintritt in den Ruhestand.
Said Issa hat, nach Aussage des Bundesaussenministeriums die BRD übrigens am 29.3.94 verlassen. (siehe in der Homepage unter Eifelkrimis: Er wurde trotzdem zur Zeit des Rafat Prozesses im Spielkasino Bad Neuenahr gesehen ...)
Kehrt-Marsch!
"Aus" für die Bodenreinigung
Was hatten Minister und Behörden den Anwohnern rund um die Espagit nicht alles versprochen. Zuerst hieß es, es gäbe gar keine Altlast. Dann wurde plötzlich "Alarmstufe rot" ausgerufen, und die aufwendigste Sanierungsaktion in der Geschichte der Eifel ausgerufen. Alles werde entfernt, bei der Espagit werde ein für allemal aufgeräumt, verkündeten Mainz und Trier unisono.
"Den Mund zu voll genommen", konnte man Anfang 1996 darauf antworten. Inzwischen zeigten sich die wahren Kosten der Wiedervereinigung und der Massenarbeitslosigkeit. Die Staatskassen waren leerer denn je. Da lag es nahe, das bisherige Sanierungskonzept bei der Espagit zu überprüfen. Zumal sich nach einer europaweiten Ausschreibung herausgestellt hatte, dass es zum Billigtarif keine Möglichkeit gab, die verseuchte Espagit-Erde zu reinigen. Die Kosten explodierten weiterhin.
Zudem warnten plötzlich Fachbehörden Argumente gegen die Bodenreinigung. Sie warnten eindringlich davor, im hochkontaminierten Werksbereich in der Tiefe zu wühlen. Das könne unabsehbare Gefahren für das Grundwasser herauf beschwören, wenn nicht gleichzeitig die vergiftete Erde entfernt würde. Ein genehmigtes Zwischenlager war aber zu dieser Zeit weit und breit noch nicht in Sicht. Die Zwangslage der Behörden war offenkundig.
So näherte man sich flugs der "Deckel-drauf-Lösung". Bekannt wurde die große Wende anno 96 durch eine Pressemitteilung des Mainzer Innenministeriums. Man lasse prüfen, "ob die Gefahren, die möglicherweise von der Altlast ausgehen, durch eine Oberflächenabdichtung vermieden werden können". Nach Vorlage weiterer Untersuchungen, so die Staatssekretäre Dr. Ernst Theilen und Roland Härtel, werde eine Entscheidung fallen. Wohin der Hase nunmehr lief, machten die beiden Staatssekretäre ebenfalls klar: In Frage käme nur eine "ökologisch verantwortbare und ökonomisch vertretbare Lösung".
Ökonomisch vertretbar: Die Zahlen sprachen für sich. Die reine Abdeckelung der Altlast, mitsamt einer Beobachtung auf Jahrzehnte hinaus, wäre nur halb so teuer wie die billigste Variante bei der Bodenreinigung, hieß es.
Am 15. Juli ließ die Bezirksregierung Trier mit einer denkwürdigen Pressemitteilung die Katze aus dem Sack. Irreführender Titel: "Munitionsräumung bei Hallschlag soll beschleunigt werden." Wegen ihrer Bedeutung wird die Verlautbarung an dieser Stelle wörtlich wiedergegeben.
"Wie die Bezirksregierung Trier mitteilt, wird die Munitionsräumung im Bereich der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag beschleunigt. Das neue Räumkonzept sieht vor, die verbleibende kontaminierte Fläche oberflächig auf Munition abzusuchen und zu räumen. Im Anschluss hieran soll das Gelände mit verzinktem Maschendraht sowie einer Lava- und Bodenabdeckung von insgesamt 50 cm Stärke abgedeckt werden. Der Oberflächen- und Zwischenabfluss wird gefasst, so dass dennoch anfallendes kontaminiertes Wasser gereinigt werden kann. Hierdurch werden sowohl unbefugte Grabungen verhindert als auch umwelttechnischen Anforderungen in vollem Umfang Rechnung getragen Die Kosten belaufen sich auf maximal 28 Mio. DM.
Das bislang entmunitionierte Gelände ist im wesentlichen von Schadstoffen unbelastet, so dass bislang keine flankierenden umweltschutztechnischen Maßnahmen erforderlich wurden.
Bisher wurde eine Fläche von ca. 13 ha bis zu einer Tiefe von durchschnittlich 1 m abgesucht und hierbei 200.000 Kubikmeter Erde umgesetzt. Man fand mehr als 1300 Granaten, davon 226 kampfstoff-verdächtig. Die in der Vergangenheit durchgeführten Maßnahmen waren erforderlich, um das Gelände nachhaltig von Munition zu säubern mit dem Ziel der Rückgabe an die Eigentümer.
Demgegenüber ist die verbleibende Fläche von ca. 15 ha derart mit Schadstoffen belastet, dass das bislang praktizierte Verfahren eines großflächigen Eingriffs zum Zweck der Munitionsbeseitigung unabdingbar eine Bodenreinigung erforderlich machen würde. Der Grund hierfür liegt darin, dass in diesem Falle die Gefahr besteht, dass Schadstoffe mobilisiert werden und ins Grundwasser gelangen können.
Das neue Räumkonzept ist damit nicht nur geeignet, die von dem alten Fabrikgelände ausgehende Gefährdung von Mensch und Umwelt zu beseitigen, sondern auch weitaus wirtschaftlicher als die ursprünglich ins Auge gefasste Tiefenräumung mit Bodenreinigung. Die Kosteneinsparung hierzu beträgt - je nach Reinigungsvariante - zwischen 25 und 70 Mio. DM.
Parallel hierzu wird eine verstärkte Absuche von Verdachtsflächen im Umkreis der ehemaligen Munitionsfabrik vorgenommen."
So verkündeten die Behörden ihre Kapitulation vor der schieren Größe der Altlast nachgerade noch als großen Sieg: Alles geht nicht nur schnell und auch noch sicher, sondern auch noch preiswerter als gedacht.
Angesichts der Fakten hielt sich die Freude jedoch in Grenzen. Immerhin hatte die Einkapselung einen unübersehbaren Nachteil: Damit würde die Zeitbombe nicht entschärft, sie tickte vielmehr unter der Erde munter weiter, als Erblast für künftige Generationen. Keines der ursprünglich hoch gesteckten Ziele wurde erreicht:
- Die chemische Verseuchung des Bodens würde nicht beseitigt, sondern nur begraben.
- Große Mengen an Munition, darunter auch Kampfgas-Granaten, werden lediglich mit Erde abgedeckt, so dass sie im Untergrund munter weiter rosten.
Und da, wo die Gefahr für die Menschen tatsächlich groß war, nämlich im Streukreis der Explosion rund um das ehemalige Werksgelände, war noch keine einzige Granate ausgebuddelt worden.
Dabei lockte Horst Miska, der Katastrophenschützer vom Innenministerium, mit einem Leckerchen: Wenn durch den Deckel-drauf-Plan die Arbeiten im Kernbereich schneller abgeschlossen würden, könnte die Munitionssuche im Außenbereich, wo die Bauern lebten, beschleunigt begonnen werden.
Nach weiteren Untersuchungen beschloss die Mainzer Landesregierung tatsächlich im Juli 97 das Ende der bisherigen Sanierung mit einem Begräbnis erster Klasse. Der Kölner Stadt-Anzeiger kommentierte damals: "Dreck drauf und schnell vergessen?"
Am Dienstag, 16. Juli 1996 beschloss die Landesregierung die Nicht-Sanierung unter dem verschleiernden Titel "Sicherungsvariante B 2".
"Das is e bisserl Quatsch", kommentierte der Chef der Munitionsräumfirma, Herbert Tauber, das neue Konzept im Kölner Stadt-Anzeiger. Aber: "Das ist der unerforschliche Ratschluss von Beamten und Politikern."
In der Folgezeit zettelte Heerwagen ein Petitionsverfahren an. Zahlreiche Bürger unterschrieben die Eingabe an den Bürgerbeauftragten des Landtages, Ulrich Galle. In der - erfolglosen - Petition wurde unter anderem gefordert:
"Ich (...) bin mit den Planungen der Behörde, die Rüstungsaltlast Espagit in Hallschlag zu konservieren und unter einem Deckel zu begraben, nicht einverstanden. Diese Rüstungsaltlast Espagit in Hallschlag passt nicht, als für Jahrhunderte zu überwachendes deponierartig verdecktes gefahrenträchtiges Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg in den von Belgiern und den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam getragenen Naturpark Nordeifel und in die vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Ferienregion der Eifel rund um den Kronenburger See. Diese immer vitale Giftlast mit des Teufels Schadstoff-Kompositionen ist eine latente Bedrohung für die Entwicklung des Tourismus in der Eifel (...). Der Erste Weltkrieg muss auch endlich für die Eifel ein Ende finden!"
Um zu verhindern, dass künftig kontaminiertes Oberflächenwasser von der Altlast in den Seifen- oder Rügelbach abfließt, soll das Oberflächenwasser an den Rändern der Espagit gefasst und gereinigt werden. Anschließend soll das saubere Wasser in die Vorflut geleitet werden. Dafür ist allerdings eine sogenannte "wasserrechtliche Erlaubnis" vonnöten, um die sich die inzwischen wieder in den Vordergrund gerückte Trierer Bezirksregierung im Jahr 1998 bemühte. Es gab Widerstände, unter anderem aus dem Euskirchener Kreishaus. Die Nordrhein-Westfalen waren "betroffen", weil alle Fließgewässer letztlich zum Kronenburger See führen, der wiederum zum größten Teil auf NRW-Territorium liegt. Auch der Hallschlager Ortsgemeinderat legte sein Veto ein, indem er zunächst das "Einvernehmen" versagte. Vielmehr forderte der Rat, dass das Land zu seinem ursprünglichen Plan mit der vollständigen Sanierung und Entmunitionierung zurück kehre.
Die Bedenken aus Hallschlag nahm die Bezirksregierung allerdings nicht sehr ernst. Deren Sprecher Wolfgang Hons erklärte der Presse, dass die Wasserrechtliche Erlaubnis auch ohne Hallschlager Zustimmung erteilt werden könne: "Die kann ersetzt werden, und zwar durch die Bezirksregierung." Wozu fragte man dann nach der Zustimmung vor Ort, wenn die beantragende Behörde sich die Erlaubnis am Ende doch selbst erteilen konnte?
Indessen liefen bei der Espagit die Vorbereitungen für die Abdeckelung mit Volldampf an. Die Oberflächen-Entmunitionierung wurde voran getrieben, am Randbereich zum Hof des Bauern Klaus Quetsch wurden große Flächen zerwühlt bei der Suche nach Sprengstoffen, der in großen Mengen gefunden wurde. Zurück blieb eine braune Erdoberfläche, auf der kein Grünzeug mehr den in den Eifelwintern häufig starken Regen zurückhalten konnte. Bereits im Sommer 1998 warnte Heerwagen davor, dass möglicherweise kontaminiertes Oberflächenwasser ungereinigt vom Sanierungsgelände fließen könnte. Mehr schlecht als recht wurden die braunen Stellen damals mit Planen abgedeckt.
Zeugen berichteten im Herbst, dass bei starkem Regen rötlich gefärbtes Wasser vom Werksgelände auf die außerhalb gelegenen Wiesen und letztlich in die Bäche geflossen sei. Diese Rot-Färbung ist ein typisches Indiz für die Kontamination mit TNT. Was den Kölner Stadt-Anzeiger wieder auf den Plan rief. Unter der Überschrift "Blümchen sollen blühen auf den Gasgranaten - Bei Regen fließt von der Espagit TNT-haltiges Wasser Richtung Kronenburger See" wurden die Probleme dargestellt. Wenn tatsächlich Sprengstoffe mit dem Wasser weggeschwemmt wurden, bestand offensichtlich die Gefahr, dass sie sich letztlich im flussabwärts gelegenen Stausee wiederfinden würden. Dazu kommentierte das Blatt zusätzlich unter dem Titel "Wahrlich explosive Geschichte" die Untätigkeit der Euskirchener Kreis-Politiker im Zusammenhang mit diesem möglichen Umwelt-Skandal an der Kreisgrenze. Zum Schluss gab es auch noch harsche Kritik an der Deckel-Lösung: "Es ist nicht ungewöhnlich, dass bekannte Gefahrenpunkte aus durchschaubaren finanziellen Erwägungen auf spätere Generationen vererbt werden. Die jetzige Politiker-Generation kann sich getrost zurücklehnen: Wenn das Thema in 30 oder 50 Jahren erneut auf die Tagesordnung kommt, weil die C-Waffen dann endgültig durchgerostet sind, wird man keinen der heute Verantwortlichen mehr beim Schlafittchen kriegen können. Dann wird man nur noch kopfschüttelnd in verstaubten Akten nachlesen können, dass im Zusammenhang mit der Espagit-Sanierung in den 90er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ziemlich viel Unsinn gemacht wurde."
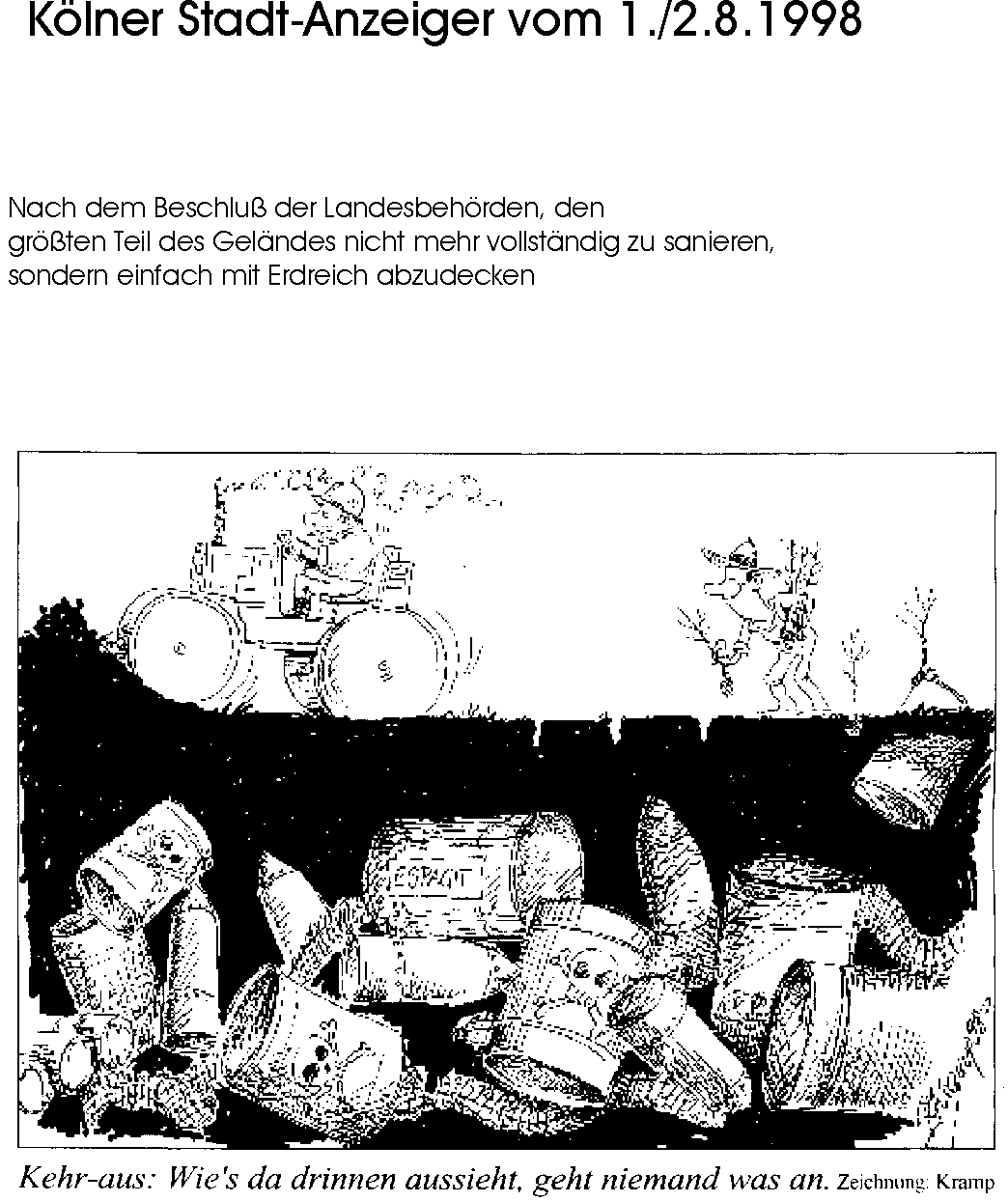
Diese Attacke verschreckte die Trierer Bezirksregierung dermaßen, dass sie sich unter Berufung auf das Pressegesetz zu einer formalen Gegendarstellung aufrafften. Die Trierer erklärten unter anderem, dass bei neun Proben, die im fraglichen Zeitraum vom abfließenden Oberflächenwasser analysiert wurden, kein TNT nachgewiesen worden sei. Auch die angebliche "Rot-Färbung" habe man nicht beobachtet. Vielmehr sei das Wasser durch Schlamm braun gefärbt gewesen. "Behörde bestreitet Kontamination", meldete der Kölner Stadt-Anzeiger.
Und Heinrich Studentkowski, inzwischen zum kommissarischen Trierer Regierungspräsidenten avanciert, war es "ein Bedürfnis", gegenüber dem Euskirchener Landrat Günter Rosenke zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Darin war die Rede von "unverantwortlicher Berichterstattung des Kölner Stadt-Anzeigers". Darin führte Studentkowski unter anderem aus, dass man auf dem Espagit-Gelände Auffangbecken für das Oberflächenwasser angelegt habe. Darin würde sich das TNT absetzen, so dass selbst bei einem Überlauf kein kontaminiertes Wasser freigesetzt würde.
TNT-Schnelltest überführt Behörden
Die Vorwärts-Verteidung der Trierer rief nun wieder Heerwagen auf den Plan. Er beschaffte sich einen TNT-Schnelltest von der Firma Merck, und bald regnete es wieder im Strömen, jede Menge Wasser schoss vom Espagit-Gelände über die Kreisstraße in Richtung Seifenbach. Heerwagen Schnelltest erbrachte hohe TNT-Werte ermittelte. Wegen des Verdachts der Gewässerverschmutzung durch die mit der Sanierung betraute Bezirksregierung rief er die Kripo auf den Plan, die tatsächlich sofort Wasserproben zog. Und zwar sowohl aus dem Oberflächenwasser als auch aus einem alten Entwässerungsrohr, das die Espagit in Richtung Seifenbach verlässt.
Am nächsten Tag zog die nun durch die Kripo bedrängte Bezirksregierung dort selbst Proben, die in einem Fachlabor analysiert wurden. Nun stand das frühere Dementi der Trierer auf dem Prüfstand, und es wurde ein grandioses Fiasko für die Behörde.
Was die Pressemitteilung zu Weihnachten 1998 über die Ergebnisse der erzwungenen Analyse allerdings eher verschleiernd darstellte: "Keine TNT-Belastung im Seifenbach" lautete der Titel der scheinbar frohen Botschaft, die in Wahrheit eine schlechte war. Im Text stand, dass aktuelle Messungen im Seifenbach unterhalb der Espagit keine Belastungen ergeben hätten. Das Institut Fresenius habe lediglich für die "Summe der sprengstofftypischen Verbindungen" Werte von maximal 25 Mikrogramm ermittelt. Und das war ja nun nicht etwa "keine Belastung", wenn man bedenkt, dass beim Trinkwasser der Summenrichtwert bei zehn Mikrogramm pro Liter liegt, wie auch die Bezirksregierung einräumte.
Weiter gab die Behörde die Ergebnisse von vier Wasserproben bekannt, die aufgrund von Heerwagens Anzeige am Rande der Espagit gezogen worden waren. Eine Probe hatte bedenkliche 190 Mikrogramm TNT. Den absoluten Spitzenwert ergab aber die Analyse des Wassers, das aus der alten Werkskanalisation munter Richtung Seifenbach strömte: 520 Mikrogramm. Genau dieser hoch belastete Kanal hatte bei Starkregen schäumend Wasser von der Altlast in Richtung Tal gesprudelt.
Mit dem offenkundigen Ziel, den aktuellen Schadstoff-Transport aus dem kontaminierten Gelände zu relativieren, gab die Behörde sogar locker vom Hocker zu, dass man vor Jahren schon im Kanalsystem der Espagit TNT-Werte von 12.000 Mikrogramm je Liter gemessen habe. Gleichwohl sei auch damals weniger als ein Mikrogramm im Seifenbach nachgewiesen worden.
Schnell-Denker könnten nun auf die Idee kommen, wenn TNT-belastetes Wasser aus dem Gelände herausläuft in Richtung Bach, dann kann es sich nicht in Luft auflösen. Selbst wenn man einen erheblichen Verdünnungseffekt durch das Bachwasser einrechnet, müsste nach Adam Riese trotzdem noch TNT im Bach und möglicherweise im dahinter folgenden Kronenburger See nachzuweisen sein. Doch alle von den Behörden durchgeführten Analysen geben keine Anhaltspunkte dafür her, dass der Kronenburger See eine explosive TNT-Fracht hat, wie immer wieder betont wird.
Jedenfalls sorgte der nun erstmals nachgewiesene Austritt von kontaminiertem Wasser für einigen politischen Wirbel. Vorkämpferin war die Grüne Bundestagsabgeordnete Michaele Hustedt (Bonn). Sie forderte bereits vor Bekanntwerden der endgültigen Analyseergebnisse: "Das Vertuschen, Verschweigen und Verschließen bei dieser Altlast muss ein Ende haben." Wenn Gunther Heerwagen mittels eines einfachen Tests das TNT im abfließenden Wasser nachweisen könne, "dann wird das jahrelange Nicht-Handeln der rheinland-pfälzischen Behörden zum Politikum." Um jede weitere Gefahr zu vermeiden, müsse die Totalsanierung des Geländes angegangen werden.
"Länderübergreifender Umweltskandal durch TNT-haltiges Wasser der ehemaligen Munitionsfabrik Espagit bei Hallschlag": So lautete das Thema in nichtöffentlicher Sitzung des Umweltausschusses im Düsseldorfer Landtag im Dezember 98. Umweltministerin Bärbel Höhn informierte über die Vorgschichte und die aktuellen Probleme. Der Kreis Euskirchen habe ihr über den unkontrollierten Abfluss von möglicherweise kontaminiertem Wasser berichtet. Obwohl der Kreis die Trierer um Abhilfe gebeten habe, sei es erneut zu unkontrolliertem Abfluss gekommen. Die Landesregierung teile die Befürchtung des Kreises Euskirchen, dass es dadurch zu Beeinträchtigungen des Tourismus am Kronenburger See kommen könne. Daher habe sie ihrer rheinland-pfälzischen Amtskollegin Klaudia Martini einen Brief geschickt. Darin habe sie sich mit Nachdruck dafür eingesetzt, "dass die Belange Nordrhein-Westfalens in wasserwirtschaftlicher Hinsicht beachtet werden".
Angesichts der hohen öffentlichen Wellen, die der unkontrollierte TNT-Austritt auf dem Wasserwege verursacht hatte, bat der Kreis Euskirchen zur nächsten Sitzung seines Fachausschusses Vertreter der Trierer Bezirksregierung zum Sachstandsbericht. Den Vortrag hielt Manfred Bitter, Abteilungsleiter für Munitionsräumung in Trier. Bitter räumte ein, dass der Abbruch des ursprünglichen Sanierungskonzeptes im wesentlichen auf Kostenerwägungen beruhe. Monat für Monat müsse er der Firma Tauber einen Gehaltsscheck über eine halbe Million Mark ausstellen. Allein zwei Millionen Mark zusätzlich seien für die Räumung des Exotentrichters vorgesehen. 50 Millionen Mark habe die Entmunitionierung bis zum Jahreswechsel 98/99 gekostet, weitere 20 Millionen würde die Sicherung der Altlast für die kommenden 50 Jahre kosten.
Bitter räumte ein, dass die Bezirksregierung "sehenden Auges" ein gewisses Restrisiko eingehe. Das sei jedoch zulässig: Auch bei Rüstungsaltlasten sei es durchaus angemessen, die Kosten im Auge zu behalten.

Im Sommer 1999 bereiteten die Trierer die Abdeckelung der Espagit vor. Gleichzeitig machten sie sich an die Vorbereitung zur Entleerung des so genannten Exotentrichters (Exoten wurden von Militärs Granaten mit unbekannter Konstruktion oder fremden Zündern genannt, oder Granaten deren Farbmarkierung für Giftgase nicht mehr erkennbar war und die man nicht zerlegen, sondern nur sprengen konnte) außerhalb der C-Zone. Da man dort mit erheblichen Giftgas-Funden rechnete - nach Angaben von Zeitzeugen sollen dort zwei Eisenbahnwaggonladungen Gasgranaten versenkt worden sein - ging man umsichtig ans Werk. Schon beim Bau der nur etwa hundert Meter langen Zufahrtsstraße zum Seifenbachtal, wo der Exotentrichter liegt, wurde man fündig. 60 Granaten wurden auf der schmalen Wegstrecke ausgebuddelt, weitere 200 beim Bau der Umleitung für den Bach. Viele dieser Granaten waren flüssig gefüllt. Und bis zum Jahresende stieg die Zahl noch einmal dramatisch an. Am 20. Dezember 99 berichteten Mitarbeiter der Trierer Bezirksregierung, dass bis dahin insgesamt fast 4000 Granaten geborgen wurden, davon allein 1893 bei der Vorbereitung zur Leerung des Exotentrichters. Bis April 2000 sollen die Arbeiten am Trichter beendet sein, schätzte Toni Hellbrück.
Text, mit freundlicher Genehmigung, unter reichlicher Nutzung eines Manuskriptes von F.A Heinen